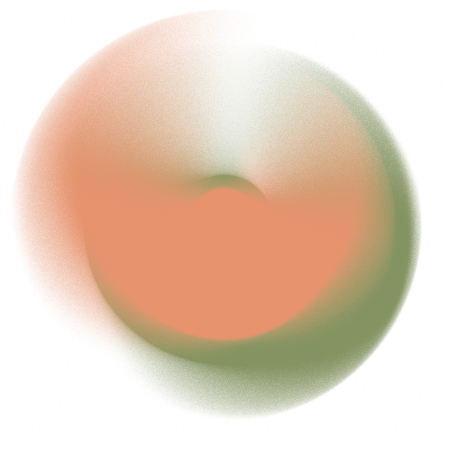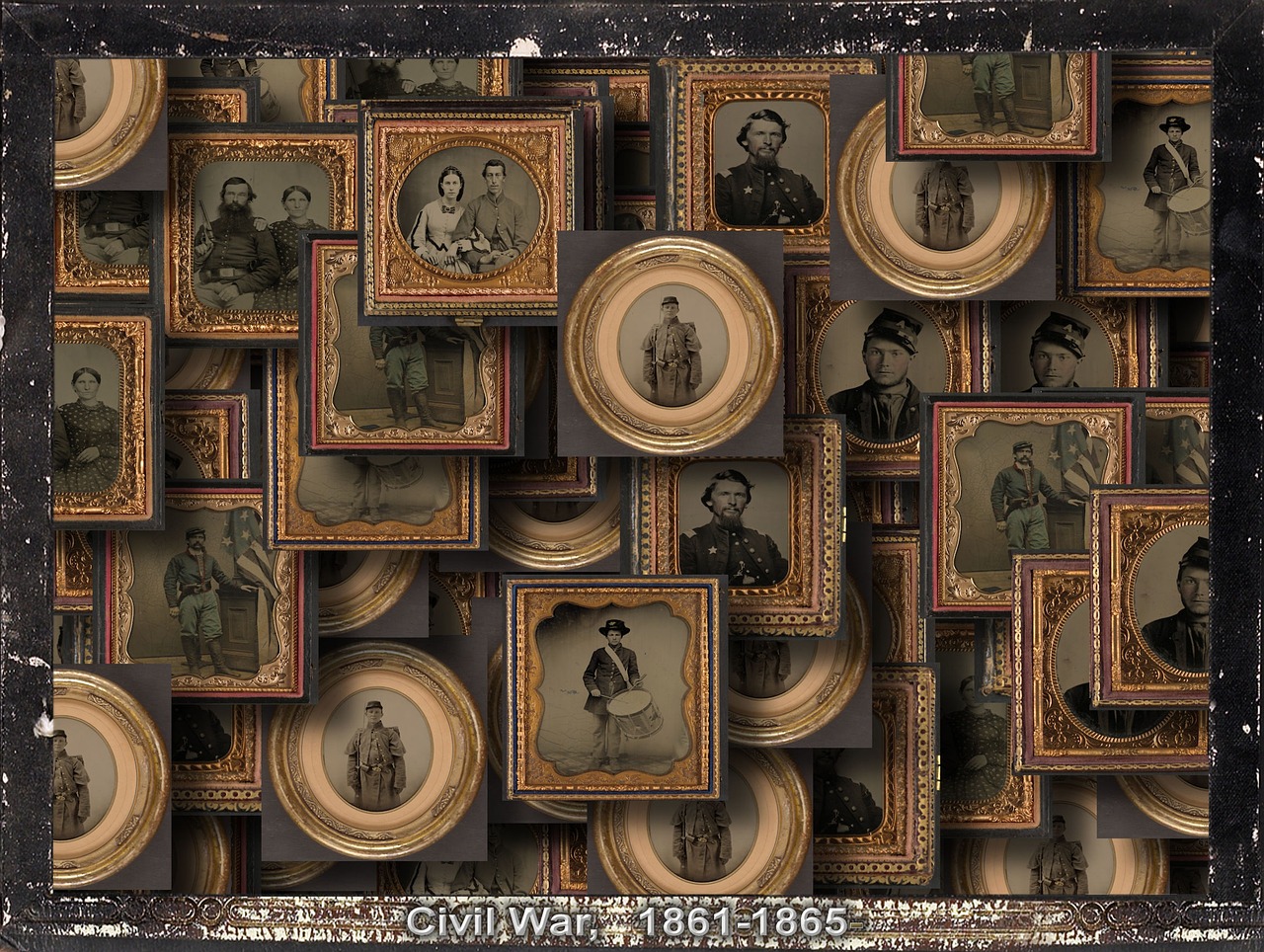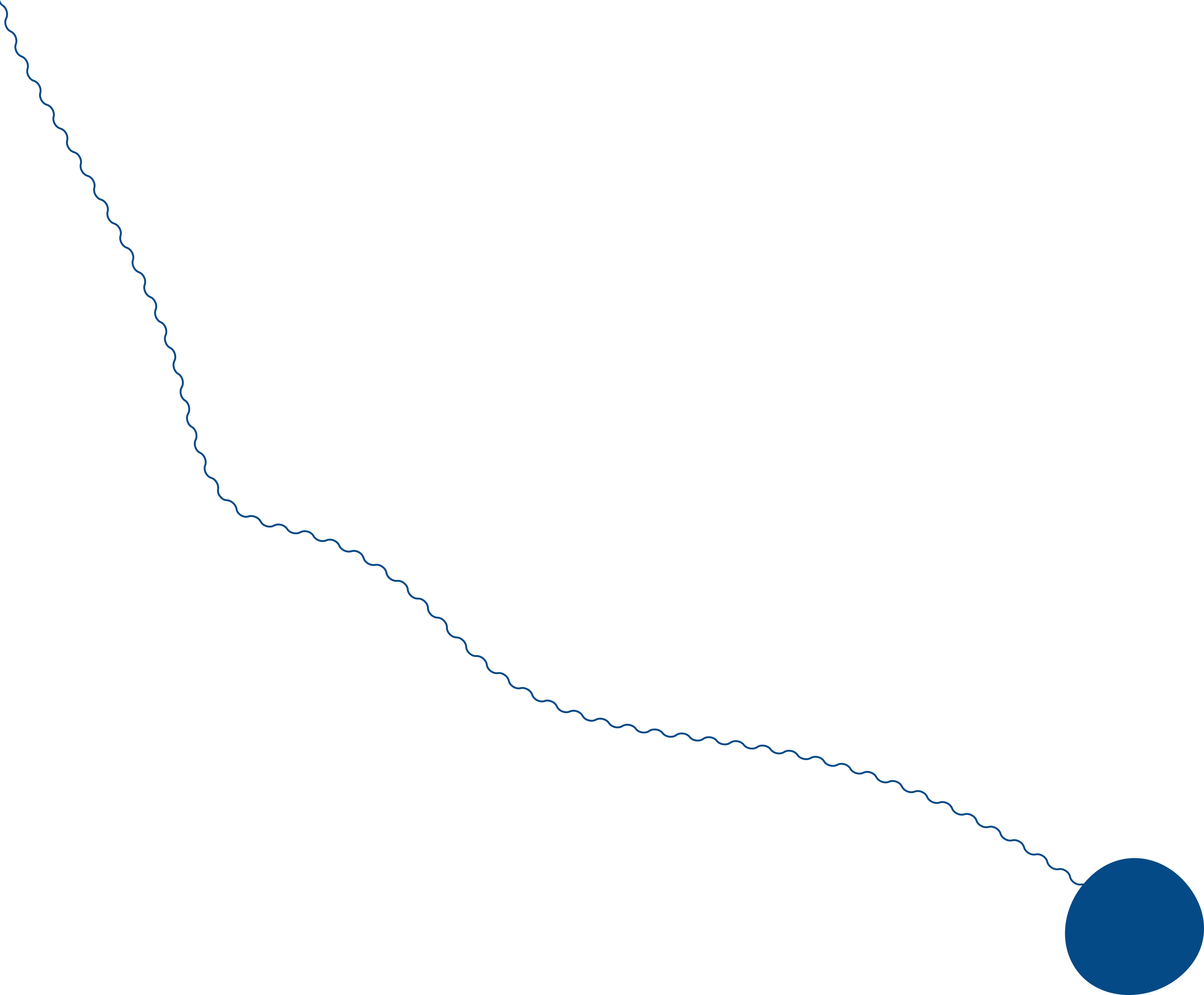Familie bedeutet für viele von uns Zugehörigkeit, Liebe, Herkunft, Geborgenheit. Und manchmal auch Überforderung, Enge, Verletzung. In meiner Praxis begegnen mir immer wieder Menschen, die sich innerlich zerrissen fühlen zwischen der Sehnsucht nach Verbindung und dem Bedürfnis nach Abgrenzung.
Wie kann ich mir selbst treu bleiben, ohne meine Familie zu verletzen? Wie viel Kontakt ist gut – und ab wann wird es zu viel?
Zwischen Nähe und Enge: Warum Abgrenzung so schwerfällt
Es ist uns evolutionsbiologisch angelegt, Teil einer Familie zu sein. In der frühen Menschheitsgeschichte war Zugehörigkeit überlebenswichtig – wer ausgeschlossen wurde, hatte kaum eine Chance. Diese tiefe Prägung wirkt bis heute nach. Abgrenzung von der eigenen Familie fühlt sich für viele Menschen an wie ein existenzielles Risiko.
Noch schwerer wird es, wenn Loyalitäten ins Spiel kommen. In der letzten Podcastfolge habe ich darüber gesprochen: Wie stark wir – oft unbewusst – an die Erwartungen und unausgesprochenen Regeln unserer Herkunft gebunden sind. Manchmal tragen wir die unausgesprochene Hoffnung in uns, dass wir durch Anpassung Liebe sichern können. Dass wir dazugehören, wenn wir brav, loyal oder verfügbar sind.
Doch diese Loyalitäten haben ihren Preis. Wenn wir uns selbst dabei verlieren, entsteht innere Unruhe. Manchmal zeigen sich die Signale in Form von Anspannung, Schlaflosigkeit oder einer ständigen Erschöpfung, die wir uns nicht erklären können.
Schuldgefühle als Wegweiser – nicht als Urteil
Viele Menschen, die beginnen, sich abzugrenzen, stoßen auf ein altes Gefühl: Schuld. Gerade dann, wenn sie es gewohnt sind, es allen recht zu machen. Wenn Nähe bisher nur durch Anpassung funktioniert hat, fühlt sich jede Abgrenzung wie ein Verrat an – an der Familie, an der alten Rolle, an dem Bild, das andere von uns haben.
Doch vielleicht ist es genau andersherum:
Echte Nähe kann erst entstehen, wenn wir uns selbst nicht mehr verleugnen. Wenn wir aus einem inneren Ja heraus in Kontakt treten – nicht aus Angst, Pflichtgefühl oder schlechtem Gewissen.
In meiner Praxis erlebe ich, dass es oft Mut braucht, die alten inneren Rollenbilder zu hinterfragen – besonders dann, wenn sie über viele Jahre unser Denken und Handeln bestimmt haben. Viele erleben es als Herausforderung, die eigenen Reaktionen wahrzunehmen, ohne sich selbst dafür zu verurteilen.
Es ist ein Prozess, sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, was wirklich zu einem passt – und was vielleicht aus einem alten Anpassungsmechanismus stammt. Die Frage bleibt:
Wie finden wir unseren Platz innerhalb der Familie – und gleichzeitig den inneren Abstand, der uns erlaubt, bei uns selbst zu bleiben?
Der besondere Fall der Patchworkfamilie
Patchworkfamilien bringen eigene, oft sehr komplexe Herausforderungen mit sich. Wenn ein neuer Partner oder Kinder aus früheren Beziehungen ins Leben treten, braucht es Offenheit, Respekt und ein echtes Willkommen – damit alle Beteiligten ihren Platz finden können.
Aber was, wenn das ausbleibt?
Wenn die Herkunftsfamilie Ihres Partners oder Ihrer Partnerin die neuen Menschen in Ihrem Leben nicht anerkennt? Wenn Ihre Kinder spüren: Wir sind hier nicht erwünscht?
Diese subtilen Ausgrenzungen schmerzen. Sie erschüttern nicht nur das eigene Selbstwertgefühl, sondern auch die Partnerschaft. Denn wenn Ihre Familie – so, wie sie heute ist – keinen Platz findet, stellt sich irgendwann die Frage: Wie viel davon will und kann ich mir zumuten?
Gesunde Abgrenzung kann bedeuten, das eigene System zu schützen:
„Das ist mein Leben, meine Partnerschaft, meine Kinder. Und ich dulde es nicht länger, dass sie ignoriert oder klein gemacht werden.“
Manchmal führt das zu klaren Konsequenzen. Rückzug aus bestimmten Kontakten. Die Entscheidung, an manchen Familienfesten nicht mehr teilzunehmen. Das ist kein Scheitern – es ist Selbstfürsorge.
Natürlich tauchen auch dabei wieder Schuldgefühle auf: Bin ich undankbar? Was denken die anderen?
Aber vielleicht ist wichtiger: Was denke ich über mich selbst? Wie lebe ich mit mir?
Veränderung beginnt in uns selbst
Oft geschieht Wandel genau dann, wenn wir ihn nicht mehr bei anderen suchen – sondern in uns selbst beginnen. Vielleicht wird die Familie, die uns lange nicht sehen konnte, neugierig auf unser neues Selbst. Vielleicht auch nicht. Entscheidend ist, dass Sie sich selbst wieder spüren und in Verbindung mit Ihrer inneren Wahrheit kommen.
Die große Familientherapeutin Virginia Satir hat gesagt:
„Ich glaube, dass das größte Geschenk, das ich jemals von jemandem bekommen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.“
Doch dieses Geschenk beginnt bei uns selbst. Wenn wir lernen, uns selbst wirklich zu sehen, zu hören, zu verstehen – dann wächst in uns der Mut, für uns einzustehen. Dann wird Abgrenzung kein Angriff – sondern ein Akt von Liebe zu uns selbst.
Auch hier kann die selbstorganisatorische Hypnose ein kraftvoller Wegbegleiter sein. Sie öffnet einen inneren Raum, in dem alte Bindungen und Muster angeschaut und neu geordnet werden können – nicht von außen, sondern aus dem eigenen inneren Wissen heraus.
Und hier geht es zu meiner Podcastfolge:https://youtu.be/nbQhsZ1SC_M